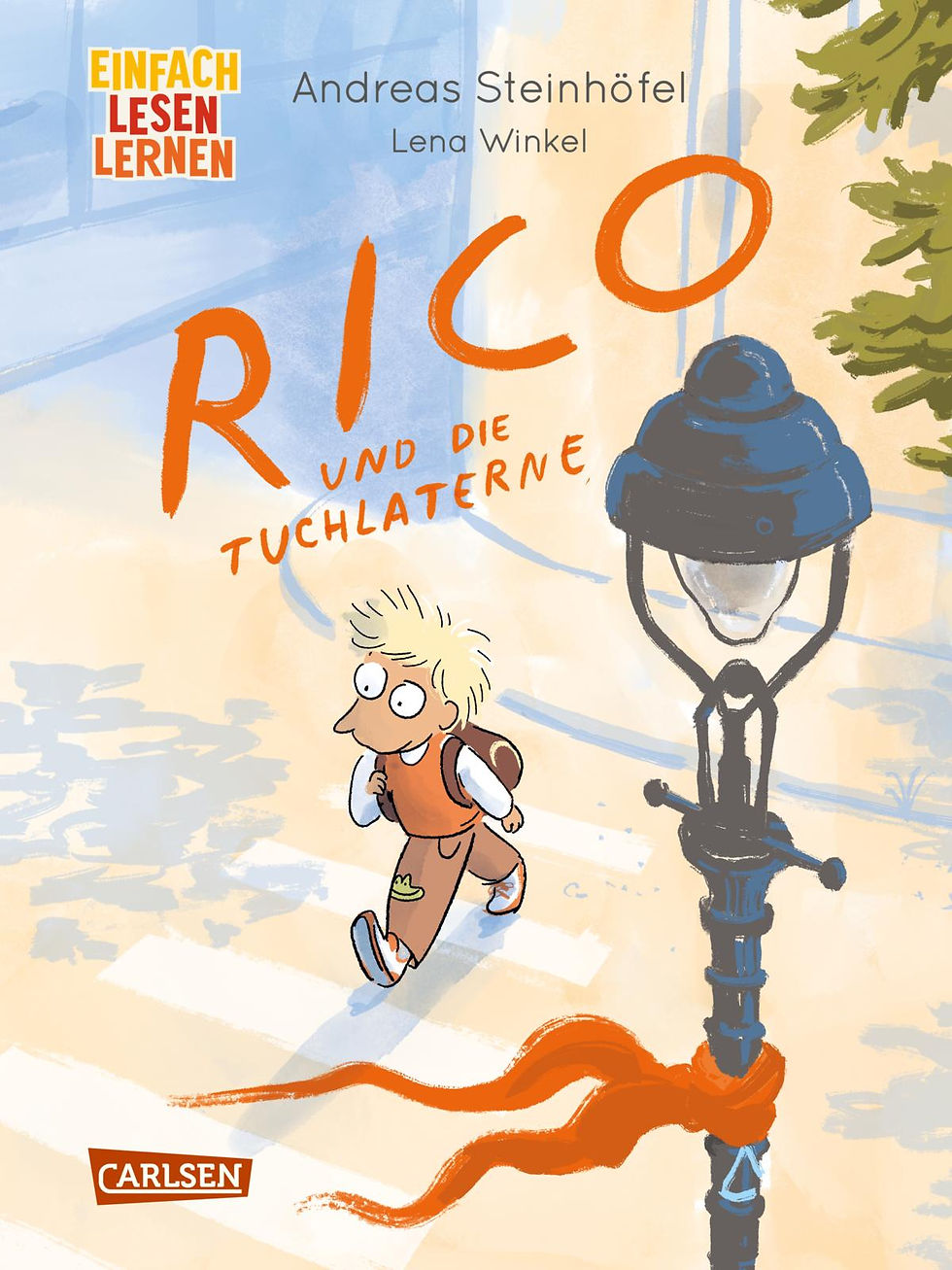Morris. Der Junge, der den Hund sucht
- 7. Mai 2025
- 5 Min. Lesezeit
Bart Moeyaert, Illustrationen: Sebastiaan Van Doninck
© Hanser Literaturverlage, München

Klasse 1-2
Deutsch Besonderheit: Ein Buch wie eine Umarmung
Es gibt viele Kinderbücher, die ihre Message vor sich hertragen – fast so, als würden sie Kindern nicht zutrauen, das Erzählte auf ihre Weise zu verstehen. Das Buch des belgischen Autors (Illustrationen von Sebastiaan Van Doninck) gehört nicht dazu. Es lebt von Leerstellen und Andeutungen und braucht die (kindlichen) Leser*innen, um zu einer Geschichte zu werden.
Morris, ein etwa sieben Jahre alter Junge, lebt bei seiner Oma in ihrem Häuschen im Wald. „Bloß für eine Weile“, denn: „Es waren traurige Dinge passiert“. Morris hat alle Hände voll zu tun, weil er auf Houdini aufpassen muss, eine Hündin, die immer wieder ausreißt und deshalb so heißt - in Anlehnung an den berühmten Entfesslungskünstler, der ebenfalls ein „Meister im Losreißen und Entkommen“ war.
Während die Oma mit ihrem Alltag beschäftigt ist, Besuch vom zwielichtigen Randy Pek bekommt und ihren Lebensunterhalt mit dem Nähen vom Patchworkdecken verdienen muss, lernt Morris durch die ausbüxende Hündin die Natur rund um das kleine Häuschen kennen. Um sich zu orientieren und sich den Weg zu merken, gibt er Felsen, Steinen oder Bäumen Namen. Morris findet sich gut zurecht in der so bezeichneten Welt; so einfach und treffend beschreibt Moeyaert die Aneignung der Wirklichkeit durch Sprache. Oder, wie er es ausdrückt: „Wenn etwas einen Namen hat, existiert es mehr als ohne Namen“.
Als Morris einmal wieder mit der eingefangenen Hündin auf dem Heimweg ist, fängt es an zu schneien. Plötzlich entkommt Houdini und verschwindet im Wald. Hin- und hergerissen zwischen seinem Wunsch, in die warme Stube seiner Großmutter zurückzukehren und der ihm aufgetragenen Aufgabe, auf die Hündin aufzupassen, entscheidet sich Morris dafür, sich auf die Suche nach ihr zu begeben.
In der nun verschneiten Landschaft ist der Junge auf sich selbst zurückgeworfen. Die Orientierungspunkte verändern sich, trotz aller Namen. Houdini bleibt verschwunden und Morris` Rufe verhallen ungehört. Dennoch ist er alles andere als verlassen; mit dem Kopf auf seinem Rumpf, dem Rumpf auf den Beinen, den Füßen im Schnee ist der Junge, so beschreibt es Moeyaert, mit der geheimnisvollen Natur verbunden. Auf diese Weise gehalten, kann er seiner Traurigkeit Raum geben: „Er schluchzte ein Mal – ein einziges Mal. Das Schluchzen war noch von letzter Nacht übrig. Wenn man heimlich weint, weint man sich nie richtig aus“.
Ein Schafbock taucht aus dem Nichts auf; kurz darauf ein Hirtenjunge, der Morris nach Essen fragt. Als dieser sagt, dass er auf der Suche nach seiner Hündin sei und nichts dabei habe, droht ihm der Junge. Schließlich habe er eine Bande, die Hasen, Hühner, Hirsche jage. Morris lässt sich nicht auf das Kräftemessen ein und bleibt bei dem, was ihm wichtig ist: „Ich suche meinen Hund“. Die beiden kommen ins Gespräch und Morris erfährt, dass der Junge kein allzu schönes Leben bei seinem Vater hat. Als der Wind auffrischt und ein Sturm aufkommt, finden die beiden Kinder Schutz im „Igel“, einem Dornenwäldchen, das Morris gut kennt.
In dieser Schutzhöhle bemerkt Morris, dass der Hirtenjunge weint. Er weiß: „Wenn jemand versucht, so leise wie möglich zu weinen, darf man nicht fragen, ob er weint. Und auch nicht, warum“. Was aber geht: Jemanden, der so traurig ist, zum Birnenkuchen seiner Großmutter einzuladen. Das wiederum ist dem Hirtenjungen zu viel: Er lehnt vehement ab und verschwindet.
Als auch Morris das Dornenwäldchen verlässt, ist der Berg tief verschneit und er ist voller Sorge um Houdini. Dann bemerkt er Flammen im Tal; ein Suchtrupp ist auf dem Weg zu ihm. Voller Freude rennt Morris ihm entgegen und stößt dabei auf Randy Pek, der ihm den Weg versperrt; in seinen Händen einen Sack, in dem er Houdini gefangen hält. Doch die Hündin macht ihrem Namen alle Ehre und kann sich befreien.
Randy Pek ist, was Morris von Anfang an wusste: Ein böser Mensch, der, wie sich herausstellt, der Vater des Hirtenjungen ist. Pek beschimpft und beschuldigt Morris und als der Mann auch noch handgreiflich wird, greift sein Sohn, der plötzlich auftaucht, ein. Durch einen Trick gerät Randy Pek in eine seiner selbst gelegten Wildtierfallen und Morris, sein neuer Freund und Houdini sind frei.
Zuhause werden die Helden von der Großmutter und den Nachbarinnen und Nachbarn mit großer Freude begrüßt. Es gibt Pfannkuchen, Waffeln und Birnenkuchen und eine neue Patchworkdecke, unter der Morris und auch Houdini Platz finden. Und der Hirtenjunge hat endlich einen Namen: Max. „Plötzlich existierte er ganz und gar“. Ganz selbstverständlich wird er von der Gemeinschaft aufgenommen.
Moeyaert entfaltet in seiner Geschichte eine autonome Kinderwelt, in der Morris auf seine Weise einen Konflikt löst und sich am Ende alles zum Guten wendet. Die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten sind dabei herausfordernd und helfend zugleich. Hineingeworfen in den (Schnee-)Sturm muss Morris nach einer Lösung suchen – und findet sie allein durch Beharrlichkeit und durch die Tatsache, dass er schon Schlimmes erlebt hat. Er hat gelernt, genau hinzuschauen und seinem Urteil zu trauen. Bösen Menschen kann er mit angemessener Klarheit, guten mit feiner Zurückhaltung begegnen. Gelernt hat er das auch von seiner Großmutter, die ihn traurig sein lässt, ohne ihn zu bedrängen oder eins zu werden mit seiner Welt.
Deine Erfahrungen musst du schon selbst machen, so könnte man Moeyaerts leise Aufforderung an die Kinder verstehen, und wenn du Glück hast, findest du Erwachsene, die dich auffangen, deine Fragen beantworten und dir helfen, dir und deiner Lebenskraft zu vertrauen. Morris` Großmutter ist eine solche Erwachsene, denn sie hat verstanden, dass manche Dinge nicht zu lösen sind, aber dass man schweigen und aufmuntern kann - und dass man Pfannkuchen, Waffeln und Birnenkuchen da haben muss, wenn jemand aus einem verschneiten Wald heimkehrt.
Zum Vorlesen eignet sich das Buch für den Deutschunterricht in Klasse 1 und 2. Das Buch beginnt mit einer Einladung an die Kinder: „Stell dich ans Fenster, mit Jacke und Mütze. Schau nicht auf deine Füße und schau dich nicht um. Frag nicht. `Wie lange dauert es noch?` Tu`s nicht. Du verpasst sonst womöglich den Anfang“. Und dann schickt der Autor die Zuhörer*innen in den Schnee, denn ohne sich vorzustellen, wie es ist im Schnee, wie es ist, wenn es schneit, sind wir Morris nicht nah. Und so zeigt das erste Bild des Illustrators Sebastiaan Van Doninck einen Jungen mit Schal und Mütze am Fenster. Gemeinsam mit Morris blicken wir hinaus in die verschneite Landschaft, dorthin, wo die Geschichte spielen wird. Sprechend, schreibend, malend können sich die Schüler*innen mit dem kargen, aber präzisen Text beschäftigen und die stillen und im besten Sinne altmodischen Illustrationen betrachten – und ihre eigenen Antworten finden.
Zum Weiterlesen: Astrid Lindgren: Guck mal Madita, es schneit. Hamburg: Oetinger 1984 und Issac Bashevis Singer: Zlateh die Geiß. In: Ders.: Zlateh die Geiß und andere Geschichten, Frankfurt a.M.: Aladin/ Thienemann-Esslinger 2017, S. 89-106 und Leo Tolstoi: Das goldene Schlüsselchen oder die Abenteuer des Burattino. Berlin: Beltz/ Der KinderbuchVerlag 2010.